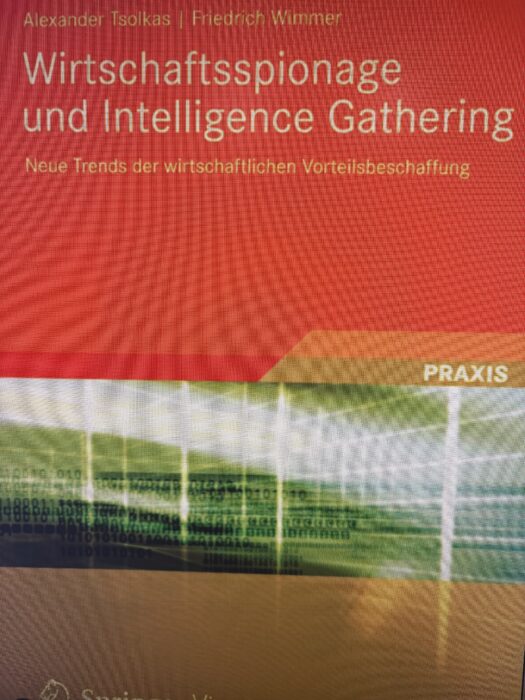Der Verwaltungsbürger ist kein schlechter Mensch. Er bemüht sich. Er macht mit. Er möchte, dass alles funktioniert.
Er füllt Formulare aus, bestätigt Hinweise, aktualisiert Daten. Nicht, weil er muss, sondern weil es einfacher ist. Weil es schneller geht. Weil es höflicher erscheint, zu kooperieren, als nachzufragen. Der Verwaltungsbürger ist freundlich. Er wartet geduldig. Er hält sich an Abläufe. Und genau deshalb fällt er kaum auf.
Früher war Verwaltung etwas, das man aufsuchte. Ein Amt, ein Schalter, ein Raum mit Wartemarken und Papier. Man trat hinein und wieder heraus, und dazwischen wurde etwas geregelt. Verwaltung war ein Abschnitt des Lebens, kein Zustand. Heute begleitet sie den Menschen. Sie wohnt in Anwendungen, in Portalen, in Profilen. Sie meldet sich mit Erinnerungen, Vorschlägen, Hinweisen. Alles gut gemeint, alles serviceorientiert, alles darauf ausgelegt, Dinge leichter zu machen.
Der Verwaltungsbürger fühlt sich umsorgt. Er bekommt Hinweise, bevor etwas schiefgeht. Er wird erinnert, bevor er etwas vergisst. Er wird geführt, bevor er sich verläuft. Es ist angenehm, so begleitet zu werden.
Doch langsam verändert sich etwas.
Der Mensch merkt, dass er nicht mehr entscheidet, wann er sich kümmert. Die Verwaltung kommt zu ihm. Sie fragt nicht laut, sie fordert nicht. Sie schlägt vor. Sie bittet. Sie erinnert freundlich. Und Freundlichkeit ist schwer abzulehnen. Der Verwaltungsbürger beginnt, sich selbst als Vorgang zu betrachten. Er denkt in Fristen, in Zuständigkeiten, in Erledigungen. Dinge, die früher Entscheidungen waren, werden zu Punkten auf einer Liste. Er erledigt sich. Nicht im existenziellen Sinn, sondern im alltäglichen. Er klickt sich durch sein Leben.
Dabei geht nichts verloren, was man sofort vermissen würde. Alles ist da. Alles ist geordnet. Alles ist nachvollziehbar.
Nur eines verschiebt sich.
Der Mensch wird nicht mehr gefragt, was er möchte, sondern ob seine Angaben vollständig sind. Ob sein Status aktuell ist. Ob seine Situation korrekt abgebildet wird. Und er bemüht sich, korrekt zu sein. Nicht, weil jemand Druck ausübt, sondern weil Unkorrektheit anstrengend wird. Sie erzeugt Rückfragen, Verzögerungen, kleine Komplikationen. Nichts Dramatisches. Nur genug, um zu vermeiden. So lernt der Verwaltungsbürger, glatt zu sein. Nicht angepasst im politischen Sinn, sondern kompatibel. Er passt in die Felder. Er entspricht den Kategorien. Er funktioniert. Dabei verliert er nichts, was sich benennen ließe. Er verliert nur das Gefühl, dass er außerhalb dieser Ordnung existieren könnte.
Der Verwaltungsbürger ist kein Opfer. Er ist das Ergebnis guter Absichten. Und genau das macht ihn so verletzlich. Denn Systeme, die nur verwalten wollen, stellen keine Fragen mehr an den Menschen. Sie kümmern sich. Sie ordnen. Sie lösen Probleme, bevor sie entstehen. Aber sie hören auf, zuzuhören.
Also was geschieht mit einem Menschen, wenn er sich selbst nur noch als gut verwalteten Fall erlebt?
Und wie fühlt sich Freiheit an, wenn alles reibungslos läuft – aber nichts mehr wirklich offen ist?
Wenn alles gut organisiert ist, stellt man keine Fragen mehr. Der nächste Schritt wirkt harmlos. Fast vernünftig. Zugang wird nicht entzogen. Er wird geprüft.
Lesen Sie morgen in Artikel 12 – Zugang unter Vorbehalt. Über ein Leben, das nur funktioniert, wenn alles passt.